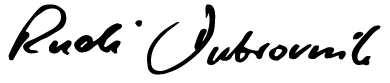[Zulu: thanda „lieben“, „mögen“; bantu „Menschen“]
Es ist eine unserer ersten Erkundungstouren von Kapstadt aus, als wir in der Gegend um Kommetjie auf der Kap-Halbinsel an einem der Kreisverkehre diese bunte Siedlung entdecken. Die aus Holz, Blechen und alten Schildern selbst zusammengebauten Hütten drängen sich in der frühen Abendsonne dicht an dicht den Hang hinauf. „Fahr mal da hoch!“ rufe ich Manni zu und er dreht eine extra Runde im Kreisel, um diesen dann über die staubige Ausfahrt bergauf zu verlassen und direkt in die Siedlung zu steuern, die wir Township nennen. Muss nicht unbedingt stimmen, denn wir nennen die Landeswährung auch Rupies, obwohl wir wissen, dass sie Rand heißt. Am Rand der schmalen Straße sind allerlei Autos geparkt, Gruppen von lachenden Kindern rennen vorbei oder spielen Spiele, die ich noch nicht kenne und überall sind Leute, die umher laufen, sitzen, stehen, sich unterhalten, essen, rauchen, rüber schauen. Es gibt kleine Shops, in denen man offenbar Lebensmittel, SIM-Karten und Guthaben kaufen kann. Wir sehen eine Bude, an der draußen eine Tafel hängt mit verschiedenen, zum Teil etwas abenteuerlich klingenden Gerichten wie „Chicken Feet“ oder „Russian“ zu so niedrigen Preisen, dass ich grinsen muss und direkt Hunger bekomme. „Lass mal hier irgendwo halten und einen Kaffee suchen“, schlage ich vor. Manni nickt ruhig mit zugespitzten Lippen, während Horst von der Rückbank ruft: „Alter, wir halten hier auf gar keinen Fall!“ Vielleicht hat er ja Recht. Immerhin wurde er mehrfach von den Freunden, bei denen wir in Bellville für die ersten Tage untergekommen waren, gewarnt. Trotzdem. Dann eben ein anderes Mal. Wie verzaubert, mit großen, strahlenden Augen und voller Begeisterung für diese vermeintlich „gefährliche“ Welt sitze ich in dem geliehenen Kia und suche im Vorbeifahren den Blickkontakt mit den Locals, der soviel mehr sagt als alle Worte dieser Welt. Manni lenkt den Wagen weiter durch den Ort, wir verursachen mit unserer Geduld für den Gegenverkehr noch einen kleinen Stau, werden angehupt, sind wenigstens ein Teil des Verkehrs hier geworden und biegen schließlich wieder auf die asphaltierte Hauptstraße Richtung Norden ab, die uns zurück nach Muizenberg zum Hostel bringt.
Am übernächsten Tag sind Manni und ich erneut zur Kap-Halbinsel unterwegs. Diesmal allein, weil die Brandung am Long Beach in Kommetjie gut ist und Horst lieber oben in der Bucht von Muizenberg bleiben will, um zu kiten. Nach unserer ersten Session auf diesem Trip in sauberen, kopfhohen Wellen sind wir am Abend überglücklich und mit einem breiten Grinsen wieder Richtung Muizenberg unterwegs. Uns knurrt der Magen.
Links neben der Hauptstraße scheint ein Markt zu sein, auf dem es bestimmt ein paar Zutaten für ein ausgiebiges Abendessen zu ersteigern gibt. Wir parken den Kia am Straßenrand vor einer Art Werkstatt, bei der ein paar Typen rumhängen. Draußen stapeln sich Reifen. Den Innenraum des Kias haben wir leer geräumt, nur die Boards sind noch aufs Dach geschnallt. Wir schlendern zum ersten Stand, wo es etwas Gemüse und Kartoffeln gibt. Die Leute sind schon dabei, zusammen zu packen. Top Timing, um Schnäppchen abzustauben. Um Angebot und Preise zu vergleichen, gehen wir weiter zum nächsten Stand, sehen daneben eine Bude mit ein paar Leuten, an der es scheinbar schon fertig zubereitetes Essen gibt und auf dem Weg dorthin höre ich aus Mannis Mund die verheißungsvollen Worte: „Ey hier gibt’s Bier!“ Im nächsten Moment begrüßt uns ein freundlicher Typ mit Käppi so nach dem Motto: „Los kommt mit, ich zeig Euch alles!“ Die Frau in der Bude macht eh gerade zu und so fällt die Wahl mal wieder auf flüssig statt fest. Mit unserem neuen Kumpel schlendern wir nach nebenan in eine von Musik erfüllte, etwas dunkle, recht belebte und wahrscheinlich „übelst gefährliche“ Lokalität, die sich als Taverne entpuppen wird. Wir schauen in teils verwunderte Gesichter und nicken den Anwesenden freundlich zu, die daraufhin teilweise zögerlich zurücknicken, andernteils auch direkt mit einem Lachen und dem typischen, dreistufigen Hand-Shake auf uns zukommen, als wären wir alte Freunde. Die Bar befindet sich im hinteren Teil, wo sich eine kleine Schlange gebildet hat. Der Tresen ist komplett vergittert. Hier muss es einen Schatz geben. Und tatsächlich, die Flaschen hier fassen 750 ml, sind von einer dünnen Eisschicht überzogen und kosten umgerechnet etwa einen Euro. Wir nehmen drei und gehen wieder nach draußen, um uns den Ort zeigen zu lassen. Und um was Essbares zu finden. Das Township heißt Masiphumelele, was auf Xhosa so viel bedeutet wie „Lasst uns erfolgreich sein“. Es ist alles da: umherrennende Kinder, Leute, die chillen, die kleinen Shops. Wir sind mittendrin und überglücklich. Bei einer Bude holen wir uns dann die „Russians“ - frittierte Würste, die eher an eine Art Fleischbrei erinnern, der beim Kauen auch gemahlene Knochen vermuten lässt. Dazu schlabberige Pommes. Mancher würde sagen, der Hunger treibt’s rein und der Geiz behält’s drin. Wir finden’s super, weil es so original ist und ziehen weiter, trinken unterwegs unser Bier, welches sich langsam dem Ende neigt. Ich ergaunre mir nach alter Manier grinsend hier und da eine Zigarette von einem der ahnungslosen Raucher und wir gehen zurück zur Taverne.
Es ist dunkel geworden, die orangefarbenen Straßenlaternen sind an und der Kia steht wider Erwarten noch immer an seinem alten Platz. Auch die Boards sind noch drauf. Der Laden hat sich inzwischen weiter gefüllt, an den Tischen ist ordentlich Stimmung, die Beats sind lauter und die Verrenkungen auf der Tanzfläche ausgelassener. In unseren Hosentaschen befindet sich nur genau soviel Bares, dass es immer mal wieder für eine Runde Bier reicht. Ab und an fragt mal jemand völlig aus der Kalten, ob wir ihm ein Bier kaufen. Einfach so. Natürlich. Nicht. Würde ich in Dresden auch nicht machen. Scheinbar denken manche hier, wir hätten eben einfach die Kohle und sie nicht. Diesem Vorurteil entziehen wir uns konsequent, sehen uns alle als gleichberechtigt an. Jeder hier hat Münzen in den Taschen, um Bier oder Zigaretten oder Gras zu kaufen. Manche wahrscheinlich gerade mehr als wir. Klar laden wir unseren Kumpel immer mit ein, wenn wir Bier holen. Und auch er holt für uns mal ein Bier mit.
Ach ja das Bier. Ich mache es dafür verantwortlich, dass das Gespräch am Nebentisch zunehmend emotionaler wird. Ein dünner, giftiger Typ hat sich mit seinem aufgebrachten Gegenüber, einem Bären von einem Mann, angelegt und will ihm wohl am liebsten an die Gurgel gehen. Ein fülliges Mädel versucht, sich mit lauten, schnellen Worten, erhobenem Zeigefinger und hin- und herbewegtem Kopf Gehör zu verschaffen. Die Szene ist herrlich. Das akustische Gulasch aus Gezeter und lauter Musik wird durch eine Flasche, die irgendwo hinter mir klirrend zu Bruch geht, etwas aufgepeppt. Der Typ, der vor mir gegen eine Säule gelehnt sitzt, schaut freundlich zu mir rüber und schüttelt verständnislos den Kopf. Er kommt nicht von hier, sondern ist der Arbeit wegen aus dem Kongo hergezogen und meint, hier haben einfach alle eine Macke. Ein anderer Typ erklärt mir, dass scheinbar immer alle denken, hier leben nur böse Menschen, die entweder kriminell oder gewalttätig oder beides sind. Bierselig sind wir uns einig, dass das totaler Quatsch ist, wir alle zusammen gehören, dass wir eigentlich Brüder sind, die sich nur vorher noch nicht getroffen haben. „No black, no white, the blood is red my friend“, sagt er und ich stimme ihm zu.
Das Bier hat sicher auch seinen Anteil daran, dass wir hier so richtig angekommen sind. Manni lässt mitten auf der Tanzfläche mit dem wohl hübschesten der anwesenden Mädels die Hüften kreisen. Ich gehe zum Kia, um meine Kamera zu holen und die Karre steht tatsächlich noch immer unverändert da. Auf dem Weg zurück zur Taverne mach ich noch einen Abstecher zum Shop gegenüber, wo man einzelne Zigaretten kaufen kann. Der Tresen ist so hoch, dass der kleine Junge neben mir auf Zehenspitzen stehen muss, um mit ausgestrecktem Arm den Schein obendrauf zu legen und „Change!“ zu verlangen. Goldig. Draußen auf dem zugeparkten Minikreisverkehr vor der Taverne ist es etwas ruhiger geworden. Ich begutachte mit einem neuen Bekannten einen City-Golf, der hier noch bis vor kurzem gebaut wurde und fühle mich fast, als ob ich schon ewig hier wohnen würde. In diesem Augenblick kommt Manni aus der Taverne und wir freuen uns riesig darüber, uns hier, irgendwo in einem Dorf in Südafrika, wie zufällig zu treffen.
Bald ist es Mitternacht und unabhängig voneinander sprechen mich nacheinander zwei unserer neuen Freunde an, um mir zu sagen, es wäre jetzt besser zu gehen. Es sei nicht mehr sicher jetzt um diese Zeit. Ich schaue rüber zum Kia, der noch immer aussieht wie vorher. Je länger ich hinsehe, umso mehr weichen die Räder Ziegelsteinen, die Scheiben Splittern und die Boards auf dem Dach gähnender Leere. Ich schüttle mir den Gedanken aus dem Kopf, begreife ihn als einen Klaps der Vernunft und hole Manni drin ab, der sich nur ungern aus einer Bar bewegt. Eine größere Gruppe hat sich um den Kia versammelt, um uns Tschüss zu sagen. Hände werden geschüttelt, mit einem warmherzigen, tiefen Blick in die Augen auch mal länger festgehalten und schließlich mit einem Lächeln und gesenkten Lidern da auf die Brust gelegt, wo das Herz schlägt.
Es ist definitiv zu früh, um sich zu trennen und überhaupt sind jetzt die Straßen leer und eine Testfahrt im Kia quasi ein Muss. Getreu der Devise „don’t be gentle, it’s a rental“ hat der Wagen mit uns generell und im Speziellen mit Manni als geübtem Testfahrer Einiges auszustehen. Einer der Freunde hat kein Vertrauen in die Karre und besteht darauf, dass ich mit einsteige. So sitzen wir zu siebent im Auto, zwei auf dem Beifahrersitz und vier auf der Rückbank, was an der steilen Kante hoch zur Straße erstmal dazu führt, dass der Schweller aufsetzt und alle vier Räder in der Luft hängen. Mit sieben Leuten ein Kinderspiel, den kleinen Kia auf die Straße zu hieven. Wie wir so die Straße entlangfahren, stellt einer unserer Freunde fest, dass wir in die verkehrte Richtung unterwegs sind. Denn wir wollen nach Fish Hoek, da hat noch was offen. Mir ist klar, was das bedeutet und Manni auch. Festhalten! Mit angezogener Handbremse dreht sich der Kia bereitwillig um 180 Grad und weiter geht’s. „I don’t wanna die!“ ruft es zunächst aus dem etwas angstverzerrten Gesicht neben mir. Ein paar U-Turns später verfallen alle in einen lachenden Sprechchor, der anfeuernd „Manni! Manni! Manni!“ ruft. Für einige der Jungs ist es echt was Besonderes, einfach so mit einem Auto unterwegs zu sein. Nur so zum Spaß. Eine Spritztour! Lachend halten sie die Köpfe in den Fahrtwind, während vorn die Lautstärke des Radios entsprechend nachgeregelt wird.
Wir stimmen zu, alle noch zuhause abzusetzen, bevor es auch für uns Zeit wird, zum Hostel nach Muizenberg zurück zu fahren. Vor einer Gasse, die zu schmal ist, um weiterzufahren, stellen wir den Motor ab und steigen aus. Es ist spät geworden und sehr still. Einer unserer Freunde bedeutet uns mitzukommen, da er uns zeigen will, wo er wohnt. Während ich total begeistert und zugleich überzeugt davon bin, in diesem Moment ein einzigartiges Privileg zu erhalten, geht Manni offensichtlich kurz die Düse als er mich entgeistert anschaut und fragt: „Sind wir eigentlich völlig bescheuert? Das können wir doch nicht machen!“ Naja gut. Da steht er also, der Kia. Mitten in der Nacht mutterseelenallein irgendwo zwischen ein paar Hütten in einem Township in Südafrika. Und wir laufen gleichzeitig mit ein paar Typen, die wir grade mal ein paar Stunden kennen auf diesen unübersichtlichen Pfaden zwischen Bretterbuden hindurch, ohne noch zu wissen, wo wir eigentlich genau sind. Und doch stehen wir letztlich in der Küche unseres Kumpels, wo ich ein paar Fotos schieße und wir uns endgültig verabschieden. Als Freunde.
Von nun an suchen wir auf unserer Tour entlang der Garden Route nach Jeffrey‘s Bay gezielt nach den Townships mit ihren günstigen Kneipen und der guten Stimmung. Wir werden sorgloser und unvorsichtig, übernachten mit unverriegelten Türen auf den umgeklappten Vordersitzen an uns unbekannten, unbeleuchteten Orten und fahren noch nach Mitternacht ins Township und zur Taverne. Wir missachten kurzum die Spielregeln und kassieren die Quittung, indem wir schlafend den Inhalt des Handschuhfachs loswerden und keine 24 Stunden später überraschend viel Platz im Auto an der Stelle vorfinden, wo vorher noch mein Koffer lag. Andererseits wird durch solche Vorkommnisse das Band zu unseren Freunden im Township gestärkt, die nun für uns die Ohren spitzen, um den Pass möglicherweise wieder aufzustöbern. Und wir lernen die Mitarbeiter der örtlichen Polizeibehörde kennen, von denen die meisten am Wochenende auch in den Tavernen der Townships unterwegs sind, um zu tanzen. Und wir sind um ein paar abenteuerliche Geschichten und etwas Lebenserfahrung reicher, was sich mit einem gestempeltem Heftchen mit Foto und einem Haufen Schmutzwäsche nicht aufwiegen lässt.
Am Ende ist es alles ein bisschen, wie wenn Du an der Küste Südafrikas Wellen reiten willst. Dann weißt Du, dass dort große Haie leben, die besten Räuber der Ozeane. Sitzt Du dann allein in der Dunkelheit und mit einer klaffenden Wunde im Wasser, stehen die Chancen bestimmt gut, als Fischfutter zu enden. Das macht ja auch keiner. Vielmehr wirst Du trotzdem dort raus gehen, weil die Wellen einfach großartig sind. Wenn Du an einem Riff surfst, kannst und wirst Du dir wahrscheinlich ein paar Schnitte am Fuß einhandeln. Und dennoch zieht es Dich dorthin, um eben diese Welle zu surfen. Die Haie und das Riff gehören dazu. Sie schärfen Deine Wahrnehmung und machen den gelungenen Ritt zu etwas Unvergleichlichem. Die Frage wird stets sein: Bist Du bereit?
Letztlich ist es das Bauchgefühl, was uns eine Situation bewerten lässt. Das Bauchgefühl wiederum rührt von unseren Erfahrungen und unserer Sicht auf die Welt her. Es beeinflusst gleichzeitig, wie sich die Welt um uns herum gestaltet. Sieh die Welt mit einem warmen Herz und lachenden Augen und Du wirst freundliche Menschen treffen, die Dir wohlgesonnen sind. Und möglicherweise wirst Du öfter den Eindruck gewinnen, dass die Menschen im Herzen gut sind und eigentlich alles in Ordnung ist, so wie es ist.